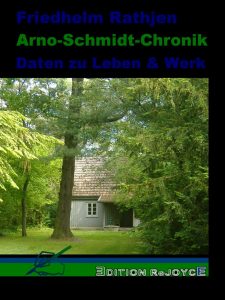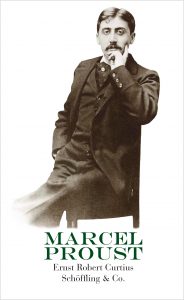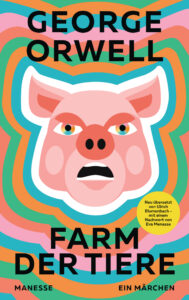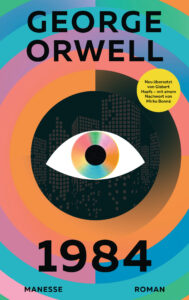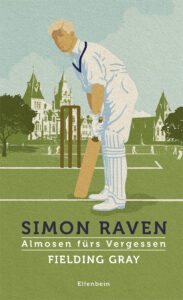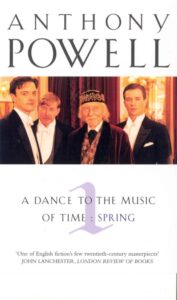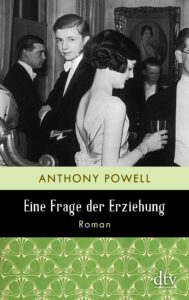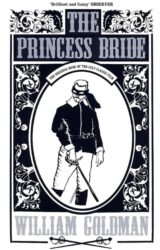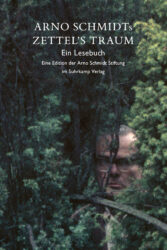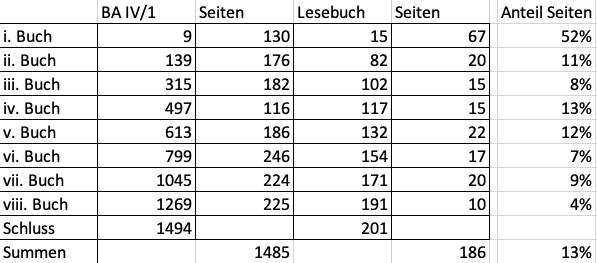George Orwell ist – zumindest in Deutschland – der Autor zweier Bücher oder vielleicht auch nur zweier Sätze: „Alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher als andere“ und “Big Brother is Watching You”. Das zeigt sich nun einmal mehr, nachdem am 1. Januar seine Texte gemeinfrei geworden sind: Es sollen allein acht Neu-Übersetzungen von Nineteen Eighty-Four und fünf von Animal Farm erscheinen,* und das obwohl Michael Walters Übersetzungen aus den 80er Jahren sicherlich immer noch tadellos und lesbar sind. Orwell zeigt also zumindest noch wirtschaftliches Potenzial. Ob es über die üblichen Schlagworte hinaus noch eine Auseinandersetzungen mit ihm geben kann, wird sich zeigen müssen.
Farm der Tiere
Wurde er gefragt, ob er seit Jones’ Verschwinden nicht glücklicher sei, sagte er nur: «Esel haben ein langes Leben. Keiner von euch hat je einen toten Esel gesehen», und mit dieser kryptischen Antwort mussten sich die anderen begnügen.
Der Text wurde Ende 1943, Anfang 1944 geschrieben, aber Orwell hatte ein wenig Mühe, einen Verleger dafür zu finden. Orwell machte dafür in einem Essay, der der Erstausgabe als Vorwort beigegeben war und den Manesse zusammen mit Orwells Vorwort zur ukrainischen Übersetzung im Anhang dieser Neu-Übersetzung mitliefert, die freiwillige Selbstzensur der Verlage verantwortlich, die in Kriegszeiten keinen Text drucken wollten, der offensichtlich gegen einen wichtigen Verbündeten und seinen politischen Führer polemisiert. Das ist nicht unwahrscheinlich, bleibt aber natürlich letztendlich Spekulation. Es mag auch sein, dass den Verlegern die Allegorie zu offensichtlich oder auch zu platt gewesen ist.
Erzählt wird von einer Revolution auf der etwas heruntergekommenen „Herrenfarm“, auf der ein sterbender alter Eber die Tiere, insbesondere die anderen Schweine, für die Ungerechtigkeit ihrer Existenz sensibilisiert. Anlässlich eines eher beiläufigen Falls herrschaftlicher Gewalt des stets betrunkenen Farmers Jones entsteht ein Aufstand der Tiere, der zur Vertreibung der Menschen von der Farm führt. Die so befreiten Tiere bilden nach der Lehre des alten Ebers eine sozialistische Kommune, in der die Schweine aufgrund ihrer Intelligenz natürlicherweise die Führungsebene bilden. Die beiden anführenden Eber, Napoleon und Schneeball, leben eine Weile in Konkurrenz zueinander, bis Napoleon, der einen Wurf junger Hunde von den anderen Tieren isoliert und zu seiner Leibgarde ausgebildet hat, in einem Putsch die Macht übernimmt, Schneeball vertreibt und alle demokratischen Strukturen abschafft.
Unter der Diktatur Napoleons treten für die Tiere – außer den Schweinen und der Polizeitruppe der Hunde – bald ärgere Verhältnisse ein als zuvor: Mehr Arbeit – es muss nicht nur die übliche Arbeit erledigt werden, sondern zudem wird noch eine weitgehend sinnlose Windmühle errichtet – und weniger Futter, da man statt Jones, seiner Frau und seinen Knechten nun die Oberschicht der Schweine durchfüttern muss, die langsam – und das ist die Endpointe des Buches – immer mehr zu Menschen werden und von ihren Nachbarn nach und nach als Geschäftspartner akzeptiert und auch hofiert werden.
Alles in dieser Erzählung ist offenbar und vorhersehbar, aber es ist auch detailliert und intelligent umgesetzt: Die Katze als Individualistin, der Esel als zynischer Stoiker und der zahme Rabe als Vertreter des Klerus sind schön ausgespielt. Es war Orwells Absicht, seine Allegorie verständlich und durchsichtig zu gestalten:
Nach meiner Rückkehr aus Spanien wollte ich den Sowjetmythos in einer Geschichte entlarven, die jedermann ohne Weiteres verstehen und die unschwer in andere Sprachen übersetzt werden konnte. [S. 159]
Der bis heute anhaltende Erfolg des Buches beweist, wie gut ihm dies gelungen ist. Das Buch eignet sich durchaus nicht nur als Allegorie auf den Stalinismus, sondern kann als Beschreibung zahlreicher Diktaturen des 20. Jahrhunderts gelesen werden. Nur bleibt das „Märchen“ letztendlich fatalistisch; die politische Vision des Sozialisten Orwell kann und sollte auch nicht thematisiert werden. Auch das machte das Buch für ein großes, besserwisserisches Publikum der westlichen Hemisphäre attraktiv.
Die Übersetzung Blumenbachs ist, wie zu erwarten, tadellos und eingängig; auf einen detaillierten Vergleich mit dem Original oder den beiden älteren Übersetzungen habe ich verzichtet.
George Orwell: Farm der Tiere. Ein Märchen. Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach. Zürich: Manesse, 2021. Pappband, Lesebändchen, 190 Seiten. 18,– €.
1984
Die Sache konnte unmöglich glücklich enden; so etwas geschah im wirklichen Leben nicht.
Nur vier Jahre nach dem Erscheinen von Farm der Tiere und dem Ende des Zweiten Weltkriegs folgte Orwells nächste Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus. Diesmal richtet sich der Text nicht nur gegen Stalinismus oder Nationalsozialismus, sondern gegen das System des staatlichen Totalitarismus schlechthin. Zu diesem Zweck entwickelte Orwell die Utopie des absoluten Machtstaates Ozeanien, der sich im Jahr 1984 seit 25 Jahren als eine von drei verbliebenen Supermächten in einem endlosen Krieg befindet. Der Staat wird beherrscht von einer namenlosen Partei, an deren Spitze wiederum der wahrscheinlich fiktive Große Bruder steht, eine absolute Führerfigur, zu der die Mehrheit der Parteigenossen bewundernd aufblickt.
Die Gesellschaft Ozeaniens ist ein Drei-Klassen-System, in dem die Arbeiterschicht – genannt Prolos – 85 % der Bevölkerung ausmachen; sie sind als Individuen vollständig bedeutungslos und dienen nur als Quelle von Arbeitskraft und Reservoir von Soldaten. Die restlichen 15 % bilden Die Partei: Mehr als 13 % gehören zur Äußeren Partei, die die alte Verwaltung abgelöst hat. Die Mitglieder der Äußeren Partei stehen potenziell unter ständiger Überwachung, die sowohl technisch als auch durch gegenseitige Bespitzelung und Indoktrination ihrer Kinder realisiert wird. Die Verwaltung ist in vier riesigen Ministerien organisiert, die als Ministerien der Wahrheit (Propaganda), des Friedens (Krieg), der Liebe (Hass, eigentlich die Geheimpolizei) und Fülle (Produktion) das Stadtbild Londons beherrschen. Die verbleibenden weniger als 2 % (immerhin noch sechs Millionen Menschen) bilden die Innere Partei, die staatliche Führung Ozeaniens im engeren Sinne. Sie leben in Luxus und Reichtum, und ihre Überwachung scheint zwar vorhanden zu sein, ist aber weniger rigoros als die der Äußeren Partei. Es gibt in Ozeanien nicht viele Informationen über die Gesellschaften der beiden anderen Großmächte Eurasien und Ostasien, aber es darf vermutet werden, dass in ihnen ganz ähnliche Verhältnisse herrschen.
Die wirtschaftliche Situation ist durch den permanenten Kriegszustand bestimmt. Die Prolos und, wenn auch in geringerem Maße, die Mitglieder der Äußeren Partei leben in ständigem Mangel. Die Ernährung ist schlecht und von Ersatzstoffen geprägt. Genussmittel existieren zwar für die Mitglieder der Äußeren Partei: Sie haben etwa Gin, Zigaretten und Schokolade, aber von so schlechter Qualität, dass selbst ihr dauerhafter Genuss keine vollständige Gewöhnung herbeiführt. Die ständige Reduzierung der Rationen wird begleitet von einer Propaganda, die deren Erhöhung und überhaupt eine kontinuierliche Steigerung der Lebensqualität verkündet. Es wird von Parteimitgliedern erwartet, dass sie diesen offensichtlichen Widerspruch ignorieren bzw. als positive gegenseitige Verstärkung begreifen können. Ob sich Ozeanien tatsächlich im Krieg befindet, ist zumindest ungewiss. Da die Partei sämtliche Nachrichtenkanäle beherrscht, ist es für ein einfaches Parteimitglied nicht möglich, die Nachrichten über den Krieg zu prüfen. Sicher aber scheint zu sein, dass niemand in der Staatsführung daran interessiert ist, den permanenten Kriegszustand zu beenden.
Konkret erzählt wird die Geschichte des Parteigenossen Winston Smith, der im Ministerium der Wahrheit an der beständigen Umarbeitung der Vergangenheit mitarbeitet. Die Aufgabe seiner Abteilung ist es, die Archive jeweils an den aktuellen Stand der Wirklichkeit anzupassen, wie sie von der Inneren Partei definiert wird. So müssen in alten Zeitungen etwa Statistiken gefälscht werden, um ehemalige Voraussagen an die aktuelle Produktion anzupassen und so die real nicht existierende Überproduktion zu beweisen. Allerdings ist es wahrscheinlich so, dass auch die aktuellen Zahlen keiner Realität entsprechen, was den betriebenen Aufwand ein wenig merkwürdig erscheinen lässt. Auch müssen die Biographien von Personen, die in politische Ungnade gefallen sind oder die ermordet wurden, aus den Archiven getilgt und die entsprechenden Passagen mit anderem Material aufgefüllt werden. Wozu diese Arbeit letztlich dient, wer also mit den gefälschten Archiven getäuscht werden soll, bleibt im gesamten Roman undeutlich. In anderen Abteilung des Ministeriums der Wahrheit werden Romane produziert, die weitgehend maschinell strukturiert und geschrieben werden. Andere wiederum arbeiten an der Ausgestaltung der Parteisprache Neusprech, die irgendwann die Alltagssprache ablösen und das Formulieren ketzerischer Gedanken unmöglich machen soll. (Bertrand Russells Konzept der Idealsprache lässt grüßen.)
Trotz seiner Zugehörigkeit zur Äußeren Partei ist Winston Smith ein heimlicher Ketzer. Er ist der Überzeugung, dass der Lebensstandard in seiner Kindheit – Winston ist 1944 oder 1945 geboren – höher gewesen sei, er glaubt zu wissen, dass das Essen früher besser war, er kann sich an den Geruch von echtem Kaffee erinnern und was der Dinge mehr sind. Außerdem weigert sich sein Gehirn, einander widersprechende Tatsachen einfach zu vergessen, also etwa dass vor wenigen Tagen die Ration an Schokolade gekürzt wurde, während jetzt die Nachricht ausgegeben wird, sie sei erhöht worden. Sein ketzerischster Gedanke aber ist, dass er sich erinnert, dass vier Jahre zuvor Eurasien der Kriegsgegner Ozeaniens war, während die Partei nicht nur behauptet, der Gegner sei Ostasien, sondern es sei auch immer schon Ostasien gewesen.
Der erste der drei Teile des Romans liefert eine Beschreibung der Ozeanischen Gesellschaft und des inneren Widerstandes Winstons. Gleich auf den ersten Seiten des Romans beginnt er, ein Tagebuch zu führen, was allein ein todeswürdiges Verbrechen darstellt. Nicht, dass es verboten wäre, das zu tun; es ist überhaupt nichts wirklich verboten, da es keine geschriebenen Gesetze mehr gibt. Zugespitzt wird Winstons Lage dadurch, dass sich ihm eine junge Frau aufdrängt, die auch im Ministerium für Wahrheit arbeitet. Beide treffen sich, haben Sex – für Genossen geächtet von der Partei, weil sie keine emotionale Bindung zu jemand anderem als dem Großen Bruder erlaubt –, richten sich ein geheimes Liebesnest ein und schließen sich auch noch der wahrscheinlich ebenfalls fiktiven Widerstandsbewegung des Staatsfeindes Emmanuel Goldstein an. Mit ihrer Verhaftung durch die Gedankenpolizei endet der zweite Teil des Romans. Der dritte beschreibt Winstons Umerziehung im Ministerium der Liebe. Die Partei legt großen Wert darauf, Winston von seinem Wahn zu heilen, dass er eine Realität wahrnimmt und erinnert, die den Aussagen der Partei widerspricht. Erst wenn das gelingt, ist Winston reif für seine Exekution.
Der Roman ist außergewöhnlich reich an Erfindungen und ideologischen Konzepten, ist überaus sorgfältig konstruiert, führt eine große Menge präziser Einzelheiten der erfundenen Welt vor, ist psychologisch glaubhaft und nimmt sowohl seinen Figuren als auch seinen Lesern jegliche Hoffnung, dass ein solcher Staat jemals zu besiegen wäre. Wie schon an anderer Stelle gesagt, ist Orwell so konsequent, dass er seinem Protagonisten jeden äußeren oder inneren Fluchtort verweigert. Orwells totalitärer Staat ist tatsächlich total. Dabei betreibt Orwell für die ideologische Seite seiner Fiktion einen ungewöhnlich hohen Aufwand. Ein nicht unerheblicher Abschnitt des zweiten Teils wird mit langen Zitaten aus einer theoretischen Analyse des Systems der Partei gefüllt, die einem Handbuch für den absoluten Staat entnommen sein könnte. Er fügt außerdem einen Anhang hinzu – wahrscheinlich der ungelesenste Teil des Romans –, der die Idee der Parteisprache Neusprech erläutert. All das macht klar, um welche Genauigkeit sich Orwell bemüht hat. Es ist, als solle diese Präzision im Detail der Beliebigkeit der Welt, die die Partei als Wirklichkeit erzeugt, gegenüberstehen.
Es ist nicht ohne Ironie, dass dieser Roman auf breiter Front als Beschreibung eines Überwachungsstaates gelesen wurde und wird. Die Überwachung betrifft bei Orwell überhaupt nur einen kleinen Teil der Bevölkerung und ist dort alles andere als absolut. Viel wichtiger als die tatsächliche Überwachung der Parteimitglieder ist die Drohung, jederzeit beobachtet werden zu können; sie vernichtet jegliches Privatleben eines Parteigenossen. In der Effektivität ihrer Überwachung sind die realen Staaten des 21. Jahrhunderts Ozeanien so weit voraus, dass Orwell wahrscheinlich staunend vor dem Phänomen stünde, dass sich in ihnen überhaupt noch irgendwer als frei empfinden kann. Andererseits ist der permanente Kriegszustand der alle anderen überwältigende Aspekt der Orwellschen Dystopie. Er dient nicht nur der Kontrolle der Bevölkerung, sondern auch dazu, sie in Armut und damit in Unwissenheit – „Unwissen ist Stärke“ ist eines der drei zentralen Schlagworte der Partei – zu halten, indem er die Überproduktion an Konsumgütern, die aufgrund des Einsatzes von Maschinen existiert, im Aufwand des Krieges vernichtet. Dabei ist es, wie Julia scharfsinnig feststellt, völlig unerheblich, ob sich Ozeanien tatsächlich im Krieg befindet oder ob es den Krieg nur inszeniert, indem es seine Raketen auf die eigene Bevölkerung abschießt.
Es mag an der Zeit sein, Orwell historisch zu lesen, um vor dieser Folie zu begreifen, wie sich Machtergreifung und -erhaltung im 21. Jahrhundert entwickelt haben, gerade jetzt, wo ein Elefant im Porzellanladen der Macht gegen seinen Willen und unter Umsturzdrohungen von der Bühne abtreten muss. Dem Totalitarismus orwellscher Ausprägung sind wir anscheinend entgangen, aber wohl um den Preis, dass die Strukturen der Macht heute subtiler geworden sind, als es für Freiheit und Würde der Menschen gut ist.
George Orwell: 1984. Aus dem Englischen von Gisbert Haefs. Zürich: Manesse, 2021. Pappband, Lesebändchen, 446 Seiten. 22,– €.
* Ich habe Ankündigungen gefunden von: Anaconda (beide Titel), dtv (beide), Fischer, Insel, Manesse (beide), Nikol (beide), Reclam (beide) und Rowohlt. Hinzukommen zwei Bearbeitungen von 1984 als Graphic Novel (Knesebeck und Splitter) und noch einige originalsprachliche Ausgaben.