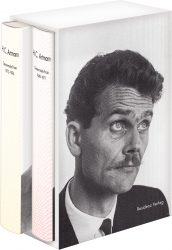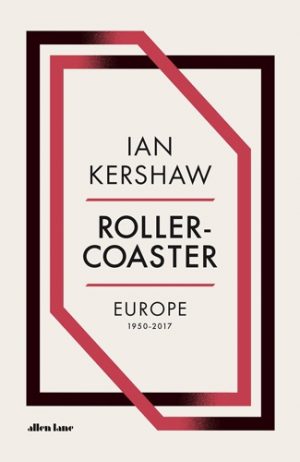«Die ganze Wahrheit? Wenn man ein Huhn zerlegt, Ethan, ist alles Huhn, trotzdem gibt es helles und dunkles Fleisch.»
Der Winter unseres Missvergnügens von 1961 ist John Steinbeck letzter Roman. Der Literaturnobelpreis, den er 1962 erhielt, veränderte seinen Status als Prominenter so stark, dass er danach bei zunehmender Krankheit vor lauter öffentlichem Engagement nur noch wenig zum Schreiben kam. So sind dieser Roman und die 1962 noch erschienene, autobiographische Reise mit Charlie seine letzten Bücher gewesen. Erzählt wird im Winter unseres Missvergnügens hauptsächlich die Geschichte Ethan Allen Hawleys, eines jungen Mannes, verheiratet, mit zwei Kindern, der seine Familie und sich als Verkäufer in einem Lebensmittelladen über Wasser hält. Der Laden hat im einmal gehört, aber er war als ein unerfahrener Kriegsheimkehrer pleite gegangen und der Käufer des Ladens, ein italienischer Einwanderer, hatte ihm eine Stelle als Verkäufer im selben Geschäft angeboten.
Die Handlung spielt in zwei kurzen Episoden um Ostern und den 4. Juli 1960 herum in dem kleinen, fiktiven, us-amerikanischen Ostküstenstädtchen New Baytown. Ethan gehört zu einer der Gründerfamilien des Städtchen, die ehemals durch den Walfang reich geworden, dann aber heruntergekommen war. Ethans Vater hatte die Reste des Familienvermögens durchgebracht und so bleibt Ethan nichts als das Haus und der Nachruhm der Familie. Sein Misserfolg als Kaufmann hängt ihm immer noch nach, aber um die Osterfeiertage herum beschließt er, in die Klasse der wohlhabenden Bürger zurückzukehren. Den Plan, mit dem er das ins Werk setzen will, entwickelt er im Laufe dieser Tage.
An der Oberfläche erzählt der Roman den Ablauf einiger weniger Tage, an denen sich eine entscheidende Wendungen in Ethans Leben einstellt. Im Hintergrund aber erzählt Steinbeck auch die Geschichte einer kleinen, von Tradition und Korruption gezeichneten Gemeinde und einer Gesellschaft, die trotz ihrer öffentlichen Moral von Ehrlichkeit, Fleiß und Rechtschaffenheit im Wesentlichen von Eigennutz, Betrug und Lügen geprägt ist.
New Baytown hatte so lange geschlafen. Jene Männer, die die Stadt regierten, in politischer, moralischer und wirtschaftlicher Hinsicht, beherrschten das Gemeinwesen schon so lang, dass sie in ihren Gewohnheiten festgefahren waren. Stadtdirektor und Stadtrat, Richter und Polizei waren für die Ewigkeit eingesetzt. Der Stadtdirektor verkaufte Baumaterial an die Stadt, und die Richter ließen Strafzettel verschwinden, wie sie es seit jeher taten, weshalb ihnen dies auch nicht illegal schien – obwohl die Gesetzbücher es behaupteten. Sie fanden es nicht unmoralisch, weil sie normale Menschen waren. Kein Mensch war unmoralisch. Die Nachbarn ausgenommen.
In diesem normalen Städtchen ist Ethan so etwas wie ein Einhorn: ein ehrlicher Mann, der sich – zumindest zu Anfang – weigert, an dem allgemeinen Spiel des Betrugs und der Bereicherung teilzunehmen. Als er dann beschließt, doch mitzumachen, soll das nicht ohne Folgen bleiben. Aber das soll jeder Leser selbst entdecken.
Der Roman ist in locker wechselnder Perspektive erzählt: Personales und Ich-Erzählen lösen einander ab; im zweiten Teil gibt es auch Kapitel, die ganz traditionell auktorial daherkommen. Breite Passagen sind dialogisch gefasst; überhaupt ist der Gegensatz zwischen dem, was die Figuren sagen, dem, was sie denken und beabsichtigen und schließlich dem, was sie tun, das zentrale Spannungselement des Romans. Steinbeck lässt sich lange Zeit, bevor er seinen Lesern erlaubt, seinem Protagonisten auf die Spur zu kommen, und selbst als der dann endlich weiß, was Ethan plant, sollte er sich nicht zu sehr darauf verlassen.
Die Neuausgabe bei Manesse ersetzt die ältere, bereits 1963 erschienene Übersetzung von Harry Kahn (Geld bringt Geld). Diese Übersetzung machte zumindest klar, wie schwierig es ist, Steinbeck gut zu übersetzen. Steinbecks Texte haben bei aller Ernsthaftigkeit ihrer Stoffe einen leichten, immer humoristischen Grundton, der insbesondere auch die Dialoge prägt. Zugleich gibt es in Der Winter unseres Missvergnügens einen durchgängigen, peu à peu wachsenden zornigen Unterton, der im letzten Kapitel auf ganz überraschende Weise kulminiert. Es ist sehr, sehr schwierig, das in einer anderen Sprache nachzubilden. Bernhard Robben ist dies alles andere als kleine Kunststück mit einer Souveränität gelungen, die man nur bewundern kann. Robben gehört schon lange zu den besten Übersetzern aus dem Englischen, aber hier ist ihm ein besonderes Meisterstück gelungen. Dem deutschen Text fehlt nichts von der Leichtigkeit und Eingängigkeit des Originals; insbesondere die ehelichen Dialoge zwischen Ethan und Mary sind mit einer Genauigkeit getroffen, die man bei Kenntnis des Originals kaum für möglich halten würde. Ein echter Glücksfall!
John Steinbeck: Der Winter unseres Missvergnügens. Aus dem amerikanischen Englisch von Bernhard Robben. Zürich: Manesse, 2018. Pappband, Fadenheftung, Lesebändchen, 606 Seiten. 25,– €.
 Wie progressiv mein Deutschunterricht gewesen ist, begriff ich erst, als mir klar wurde, dass die Kenntnis von Gedichten Ernst Jandls oder Gerhard Rühms durchaus nicht zur Allgemeinbildung der meisten deutschen Gymnasiasten gehörte. Dass jene Gedichte, die ich unter dem Schlagwort „Konkrete Poesie“ kennengelernt hatte, eine sehr moderne Spielart der Lyrik waren, war mir klar; eine wie schmale Spalte sie bildeten dagegen nicht. Und noch später fand ich dann erst die Vorläufer, die spätestens seit der Barocklyrik existieren. Dass diese Spielart des Wortspiels überhaupt so bekannt ist, wie sie es ist, verdankt sich zu einem wesentlichen Teil auch der Sammlung Eugen Gomringers, die 1972 zum ersten Mal erschien und eine essentielle Auswahl vorstellte. Reclam hat nun im vergangenen Jahr eine erweiterte Neuauflage des Bändchens aufgelegt, die zusätzlich Gedichte von neun weiteren Autoren liefert.
Wie progressiv mein Deutschunterricht gewesen ist, begriff ich erst, als mir klar wurde, dass die Kenntnis von Gedichten Ernst Jandls oder Gerhard Rühms durchaus nicht zur Allgemeinbildung der meisten deutschen Gymnasiasten gehörte. Dass jene Gedichte, die ich unter dem Schlagwort „Konkrete Poesie“ kennengelernt hatte, eine sehr moderne Spielart der Lyrik waren, war mir klar; eine wie schmale Spalte sie bildeten dagegen nicht. Und noch später fand ich dann erst die Vorläufer, die spätestens seit der Barocklyrik existieren. Dass diese Spielart des Wortspiels überhaupt so bekannt ist, wie sie es ist, verdankt sich zu einem wesentlichen Teil auch der Sammlung Eugen Gomringers, die 1972 zum ersten Mal erschien und eine essentielle Auswahl vorstellte. Reclam hat nun im vergangenen Jahr eine erweiterte Neuauflage des Bändchens aufgelegt, die zusätzlich Gedichte von neun weiteren Autoren liefert. Ergänzend hat Gomringer im Jahr 1996 den Band „visuelle poesie“ zusammengestellt, dessen Beiträge einen deutlich stärkeren optischen Einschlag haben. Wer sich den einen Band besorgt, sollte auch gleich den anderen mit bestellen.
Ergänzend hat Gomringer im Jahr 1996 den Band „visuelle poesie“ zusammengestellt, dessen Beiträge einen deutlich stärkeren optischen Einschlag haben. Wer sich den einen Band besorgt, sollte auch gleich den anderen mit bestellen.